Mit Mineralwolle angenehme Temperaturen unterm Dach – auch im Sommer.
Gemütlich warme Wohnräume schaffen ein behagliches Zuhause. Im Sommer können die Raumtemperaturen jedoch Werte erreichen, die die Bewohner körperlich beeinträchtigen und ihre Leistungsfähigkeit einschränken. Vor allem Dachräume sind davon betroffen, wenn die pralle Sonne auf die Dachflächen trifft und Hitze nahezu ungehindert eindringen kann. Hier ist ein wirksamer sommerlicher Hitzeschutz gefragt, den eine Dämmung mit Mineralwolle leisten kann.
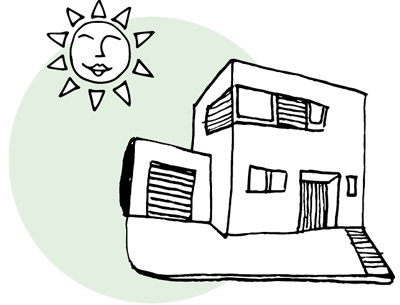
Die Wohlfühltemperatur in Wohnräumen liegt meist bei 20 bis 23 °C. Manche Menschen empfinden auch 25 °C noch als angenehm. In Schlafräumen liegen die Werte etwas niedriger – hier sind 16 bis 19 °C besonders förderlich für einen erholsamen Schlaf.
Steigt das Thermometer auf deutlich höhere Temperaturen, wirkt das schweißtreibend, belastet den Kreislauf und schränkt sogar das geistige Leistungsvermögen ein.
Neben großzügigen Fensterflächen sind vor allem die Dachschrägen das Haupteinfallstor für die Hitze. Eine ungedämmte Dachkonstruktion aus Sparren und Dachsteinen kann die wärmenden Sonnenstrahlen nur kurze Zeit aufhalten. Dachziegel oder Betondachsteine heizen sich durch die Sonneneinstrahlung innerhalb kürzester Zeit auf und geben dann die Hitze ungehindert an die darunterliegenden Räume weiter.
Mit der Mineralwolldämmung greift hier eine Maßnahme, die man ohnehin gegen Wärmeverluste während der kalten Jahreszeit einsetzt: der Einbau einer effizienten Dachdämmung.
Der Grund dafür: Mineralwolle wirkt dadurch, dass sie Wärme schlecht leitet und damit den Wärmedurchgang wirksam abbremst. Dieses Wirkprinzip funktioniert in beide Richtungen: Im Winter lässt die Mineralwolle die Wärme nicht nach außen entweichen, im Sommer lässt sie die Hitze nicht von außen eindringen – so oder so stellt der Dämmstoff eine leistungsfähige Barriere für Wärmestrahlung dar.
Ist eine Mineralwolldämmung in die Dachschrägen eingebaut, ist also ein wichtiger Schritt beim sommerlichen Hitzeschutz bereits geschafft.
Bei den Außenwänden handelt es sich in der Regel nicht um Leichtbau-Konstruktionen wie beim Dachstuhl, sondern hier werden meist massive Wandbaustoffe eingesetzt. Diese Materialien bringen im Rahmen des Hitzeschutzes eine hilfreiche Eigenschaft mit: Sie können Wärme speichern und lassen sie nicht sofort durch.
Dieser Effekt wird stärker, je dicker die Wände sind. Da dies meist zu Lasten wertvoller Wohn- und Nutzfläche geht, ist es sinnvoll, diese Funktion mit einer Dämmung von außen zu unterstützen.
Eine Fassadendämmung, wie etwa ein Wärmedämmverbundsystem aus Mineralwolle, hindert dann als Wärmebarriere einen guten Teil der Hitze daran, in die Wand einzudringen. Auch eine zweischalige Wand mit einer Kerndämmung aus Mineralwolle hält den Wärmedurchgang stärker auf als eine homogene, gemauerte Fassade. Und bei der gedämmten, hinterlüfteten vorgehängten Fassade kommt hinzu, dass die eigentliche, gemauerte Wand von dieser Konstruktion beschattet wird.
Bei der Planung eines Neubaus oder einer umfangreichen Sanierung sollte man natürlich nicht bei Dachflächen und Mauerwerk stehenbleiben. Ein nicht geringer Teil der Außenhülle eines Hauses besteht auch aus Fenstern – im Dach ebenso wie an den Fassaden. Und wo erwünschtermaßen Sonnenlicht eindringt, ist der Weg auch für Sonnenwärme weitgehend frei.
Hier können Vorkehrungen schon sehr einfach den Hitzeschutz verbessern: Auf eine – möglichst außen angebrachte – Beschattung sollte man dabei
keinesfalls verzichten. Bei Dachflächenfenstern lässt sich das mit Außenrollläden problemlos realisieren, an der Fassade stellen Markisen eine zusätzliche Möglichkeit dar. Plant man ein Haus neu, können auch großzügige Dachüberstände Teile der Fassade beschatten.
Zusammen mit der Dämmung tragen diese Maßnahmen zu einem Gesamtpaket bei, das die gesamte Außenhülle berücksichtigt und das übermäßige Aufheizen der Innenräume verhindert.

Tagsüber steigen die Temperaturen, nachts kühlt es bis zum frühen Morgen wieder ab. Genau das jedoch soll im Haus oder in der Wohnung nicht spürbar sein. Eine gute Dämmung hilft, diese Temperaturunterschiede gering zu halten.
Kalkstein, Feldspat, Dolomit, Basalt und Diabas für die Herstellung von Steinwolle beispielsweise kann an der Erdoberfläche gewonnen werden. Die etwa 70 Prozent Altglas, aus denen Glaswolle besteht, stammen aus bundesweit verteilten Sammelstellen und sind ebenso einfach verfügbar wie der außerdem benötigte Sand.
Ein interessanter Aspekt des Hitzeschutzes wurde schon kurz beleuchtet: Tagsüber steigen die Temperaturen, nachts kühlt es bis zum frühen Morgen allmählich wieder ab. Die Temperaturentwicklung verhält sich also wellenförmig und lässt sich als Kurve zeichnen, die abwechselnd steigt und sinkt. Solch eine Wellenkurve kann stärker oder schwächer nach oben und unten ausschlagen. Wie stark die Veränderung jeweils ist, bezeichnet man mit dem Begriff Amplitude – bei stärkeren Ausschlägen ist die Amplitude groß, bei schwächeren ist sie klein.
Was hat das nun mit dem Hitzeschutz zu tun? Ganz einfach: Ziel der Maßnahmen ist es, die Ausschläge der Kurve zu verkleinern. Denn je weniger die tatsächliche Temperatur von der gewünschten mittleren Temperatur abweicht, desto besser. Indem man also dämmt, damit es weder zu starken Temperaturanstiegen noch zu starken Temperaturrückgängen kommt, verringert man die Ausschläge.
Fachleute sprechen dann von der Amplitudendämpfung – für die Bewohner bedeutet es, den Unterschied zwischen zu kalt, zu warm und Wohlfühltemperatur zu verringern. Eine Mineralwolldämmung erreicht genau das: ein Dämpfen der Temperaturschwankungen.
Wenn man schon die Temperatur als Kurve betrachtet, dann lohnt sich auch ein Blick darauf, wann die Werte besonders hoch und wann sie besonders niedrig sind. Beim Hitzeschutz ist das wichtig, weil ohne jede vorbeugende Maßnahme die Hitze ins Innere des Hauses weitergeleitet wird, wenn sie auf die Außenhülle des Hauses trifft. Das ist ungünstig, denn genau zu diesem Zeitpunkt kann das Haus nicht abkühlen. Ein Baustoff, der Wärme speichert, kann dieses Eindringen der Hitze verzögern. Das Mauerwerk nimmt Hitze auf, die Mineralwolldämmung nimmt ebenfalls einen Teil von Hitze auf und sorgt außerdem dafür, dass sie nicht zum Mauerwerk vordringt. Alles zusammen verzögert den Zeitpunkt, zu dem die Wärme ins Haus eindringen würde – und zwar idealerweise so weit, dass dann schon die nächtliche Abkühlung eingesetzt hat.
Den Zustand, in dem sich eine Welle zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet, ob sie also gerade einen Wellenberg oder ein Wellental zeigt, nennen Physiker Phase. Indem man den Zeitpunkt verschiebt, zu dem Wärme durch ein Bauteil gedrungen ist, verschiebt man also die Phase der Welle, folglich nennt man das Phasenverschiebung. Wenn Sie also von der Phasenverschiebung beim Hitzeschutz lesen, bedeutet das, dass das Eindringen der Hitze soweit verschoben wird, dass die Außenbauteile schon wieder abkühlen können, ehe die Wärme im Inneren zu lästig wird.